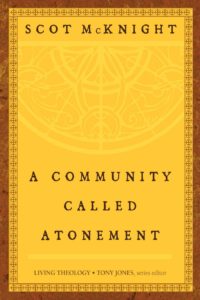„Öffentliche Theologie“ – auf diesen Begriff bin ich zuerst im Buch „Öffentlich glauben“ von Miroslav Volf gestoßen. Für mich war das ein Schlüsselbegriff: wie kann man als Christ und Theologe in der Öffentlichkeit reden, ohne vorauszusetzen, dass Gott und die Bibel per se schon anerkannte Autoritäten sind? Es geht also nicht ums Reden im gemeindlichen Raum, auch nicht im universitären Fachjargon, aber auch nicht in der halben Privatheit des Gesprächs „über’n Gartenzaun“. Sondern um Situationen, wo die grundsätzliche Sicht auf die Welt öffentlich verhandelt wird: bei Podiumsgesprächen, in öffentlichen Diskussionen, am Volkstrauertag, auf Demos und anderswo.
Wenn ich als Theologe dort nur die Fakten und Zusammenhänge runterbete, die die anderen auch schon genannt haben, kann ich mir meinen Beitrag schenken. Gleichzeitig kann ich aber nicht voraussetzen, dass die Gesprächspartner meine Prämissen teilen. Ich kann nur damit überzeugen, dass ich etwas Treffendes, Hilfreiches und Überzeugendes zur Sache sage, um die es geht. Ich werde natürlich im Kern nichts anderes sagen als am Sonntag im Gottesdienst. Aber das Framing ist anders, und deswegen muss ich auch anders reden. Ich muss mein Anliegen so ausdrücken, dass ich eine Brücke baue zum Verständnishorizont meiner Gesprächspartner oder Zuhörer.
Auch die Form ist wichtig. Wir haben heute auf der einen Seite die nicht enden wollenden, drögen Monologe und Grußworte, bei denen hörbar und einschläfernd das Papier raschelt. Auf der anderen Seite die tagesschautauglichen 10 Sekunden-Statements, die die Zusammenhänge heillos versimpeln. Und dann noch Formate wie Comedy und Poetry Slam, wo die unterhaltsame Form entscheidender ist als der Inhalt. Keins davon passt zur Öffentlichen Theologie. Zum Vorbild passt eher die biblische Weisheit, die ihre Wahrheiten in so pointierte Formulierungen brachte, dass manche davon bis heute als Sprichwörter überlebt haben. Sie sind einprägsam, einfach und klar, manchmal voll hintergründigem Humor und aus sich selbst heraus plausibel. Plausibilität – das ist ein Schlüsselwort. Im Idealfall ist Öffentliche Theologie aus sich selbst heraus plausibel.
Aber muss denn nicht der Name Gottes, der Name Jesu explizit genannt werden? Nun, in der Regel bin ich in solchen Situationen sowieso als Theologe und/oder Vertreter der Kirche bekannt. Die Gesprächspartner und Zuhörer erwarten ja, dass ich einen christlichen oder wenigstens religiösen Standpunkt vertrete. Je selbstverständlicher ich diese Position einnehme und sie für das jeweilige Thema fruchtbar werden lasse, um so selbstverständlicher wird sie auch akzeptiert. Wenn ich erst anfange, mich umständlich zu erklären oder gar zu entschuldigen, haben die Leute zu Recht den Eindruck, dass da etwas nicht stimmt. Aber wenn mich jemand nach meinen Quellen befragt, werde ich damit nicht hinterm Berg halten. Wir müssen nicht immer ein dickes christliches Etikett draufkleben. Aber wir müssen die christlichen Wahrheiten so sagen, dass sie erhellend wirken, die Themen öffnen für die Wirklichkeit Gottes und dadurch Alternativen ermöglichen.
All das kam mir jetzt in den Sinn, als ein Statement bei der Demo unseres lokalen Klimabündnisses auf mich zukam, zwei Tage vor der Bundestagswahl. Ein gemischtes Publikum vom Grundschüler bis zur altgedienten Aktivistin. Also genau die richtige Situation für Öffentliche Theologie. Und die Länge von zweieinhalb Minuten war allen Rednern vorgegeben. Wer also schauen will, was für mich dann Öffentliche Theologie ist, kann es hier nachlesen.