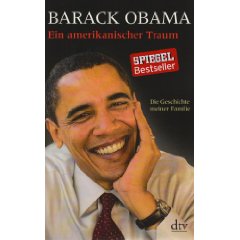Barack Obama ist schwarzer Amerikaner mit einem ungewöhnlichen Lebenslauf: sein kenianischer Vater lebte weit entfernt, er wuchs auf bei seiner weißen Mutter und ihren Eltern in Hawaii, für einige Zeit auch in Indonesien, in einer wenig rassistisch geprägten Umgebung. So ist ihm in seiner Kindheit lange nicht wirklich klar gewesen, dass er schwarz ist.
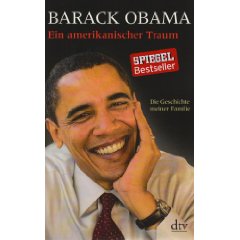
Von der Hautfarbe eingeholt
Trotzdem hat ihn in seiner Jugend seine Hautfarbe eingeholt. Ich habe bisher noch nirgendwo so eindrucksvoll wie in Obamas Buch beschrieben gefunden, was es bedeutet, ein schwarzer Amerikaner zu sein: seiner Hautfarbe nicht entkommen zu können, von ihr her definiert zu werden, auf Ablehnung oder herablassende Freundlichkeit zu stoßen. Eine weiße Freundin zu lieben und zu wissen: in ihrer Familie werde ich immer ein Fremder bleiben. Immer wieder zu spüren: ich bin anders, ausgeschlossen, für mich ist vieles nicht einfach normal, was für Weiße selbstverständlich ist.
Obama beschreibt Wege, mit denen er und andere auf diese Situation als schwarze Amerikaner reagiert haben: z.B. unter sich bleiben, das Problem ignorieren, Selbsthass, eine bewusst schwarze Identität ausbilden, Islam, Drogen, sich irgendwie durchschlagen.
Wendepunkt Chicago
Anscheinend war es für Obama der entscheidende Schritt, dass er 1985 mit Stadtteilarbeit in der Southside von Chicago begann – einem Stadtviertel, das durch die Schließung der Stahlwerke in Arbeitslosigkeit und Depression abzurutschen begann. Hier bekam er praktischen Kontakt mit den Traditionen der Bürgerrechtsbewegung (die er schon von seiner Mutter her kannte), und hier stieß er auf die Kraft der kleinen Leute, die sich ohne großes Pathos trotz ihrer desolaten Lage die Hoffnung bewahren und daraus Kraft schöpfen, auch wenn sie nicht unempfänglich sind für selbstschädigende Einflüsse. Beides hat ihm wohl geholfen, für sich einen Weg jenseits des schwarz/weiß-Gegensatzes zu finden. Hier lernte er auch in der Trinity-Gemeinde von Rev. Wright ein Christentum kennen, das gerade in seiner Spiritualität relevant war für die schwarzen Gemeindemitglieder.
Auf der Suche nach den Wurzeln
In dieser Situation fasste er zwei Entschlüsse: Jura zu studieren, um die Machtverhältnisse von innen heraus zu verstehen, und vorher die Familie seines inzwischen verstorbenen Vaters in Kenia zu besuchen. Dem Besuch in Kenia ist der dritte Teil des Buches (nach Kindheit/Jugend und Chicago) gewidmet. Obama beschreibt ihn mit allen Licht- und Schattenseiten: Armut und Korruption, die Verantwortungslosigkeit der Männer, den Streit in der Familie. Die Herzlichkeit und Liebenswürdigkeit der Menschen, das Zugehörigkeitsgefühl, das er dort sofort erlebt, obwohl er vorher mit der Familie noch nie zu tun hatte. Die Hoffnungen auf eine bessere Zukunft, die aber immer wieder verraten werden. Er beschreibt, ohne zu verurteilen oder zu glorifizieren. Am Ende sitzt er am Grab seines Vaters, der im Zerbrechen der alten Gesellschaft und der Begegnung mit der weißen Moderne versucht hat, seinen Weg zu finden und immer wieder an seine Grenzen gestoßen ist – wie schon der Großvater.
An dieser Stelle ist das Buch fast zu Ende. Es folgt ein Blitzlicht auf Obamas Jurastudium (und seinen Versuch, Gesetze wieder als Ausfluss der Ideale von 1776 zu lesen) und am Ende eine kurze Schilderung seiner Hochzeit mit Michelle, die aus der Southside von Chicago kommt. Die Trauung hält Rev. Wright. In den Gästen sind alle Traditionslinien, denen Obama sich verdankt, repräsentiert, von Afrika über Hawaii bis Chicago. Es ist eine optimistische Szene, voller Hoffnung, und Obama schließt mit den Worten, dass er in diesem Moment der glücklichste Mensch der Welt war.
Integration auf der Basis amerikanischer Ideale
Obama hat seinen Weg gefunden: die Realität, einschließlich der schmerzhaften Vergangenheit, muss wahrgenommen werden, mit ihrem ganzen Licht und ihren Schatten. Aber sie muss zusammengebracht werden mit den besten Traditionen Amerikas. Wo das Christentum so fundamentalistisch verseucht ist wie in den USA, redet ein säkular geprägter Mensch wie Obama lieber vom „amerikanischen Traum“ als vom Evangelium. Aber in der Argumentationsstruktur des Buches wie in seinen späteren Reden steht der „amerikanische Traum“ genau an der Stelle, wo – theologisch gedacht – der Ort des Evangeliums wäre.
Was Obama 1995 aufgeschrieben hat, passt zu dem, was er seit 2004 in seinen politischen Reden als Programm entfaltet. Es ist die Aufnahme eines enorm breiten Realitätsspektrums, das ihn glaubwürdig erscheinen lässt. Die Integration all dieser Wirklichkeiten im Zeichen des amerikanischen Traumes ist das Thema fast aller seiner Reden – so durchgehend, dass es im Internet schon eine Anleitung „Verfass deine eigene Obama-Rede“ gibt.
Werte realpolitisch
Man kann an Obama sehen, dass es im Hintergrund der Politik auch ganz machtrealistisch um die kreative Bildung von Werten geht. Sie können neue Mehrheiten produzieren. Was als persönlicher Kampf eines Schwarzen aus Hawaii um seine Identität begann (und schon viel früher als Aufbruch seines unangepassten Großvaters), hat 30 Jahre später weltweite Folgen.
Wie sich das im Alltagsgeschäft der Politik bewähren wird, ist die Frage der Zukunft. Kaum einer kommt da ohne Schrammen durch. Wer Versöhnung auf seine Fahnen geschrieben hat, kann Probleme bekommen, wenn sich reale Gegensätze zuspitzen und nicht mit Formeln zu überbrücken sind. Aber man kann klar erkennen, dass Obamas Grundansatz fest in seiner Biografie verankert ist. Es ist kein rhetorischer Trick zum Zweck der Präsidentenwahl (und deswegen ist er auch nicht mal schnell für die deutsche Bundestagswahl kopierbar). Gut, wenn ein amerikanischer Präsident so breit mit der Realität umgehen kann – auf eine fast kontemplative Weise. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Hoffen und beten wir, dass sein Secret Service besser auf ihn aufpasst als auf Kennedy.
Im nächsten Post dieser Reihe will ich mir Gedanken über den Zusammenstoß der weißen Moderne mit den älteren indigenen Kulturen machen – das Problem, das Obamas kenianische Familie seit mindestens drei Generationen bewegt und verstört hat.