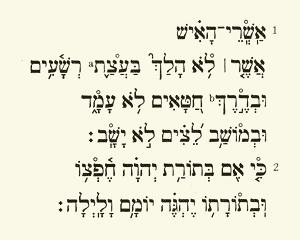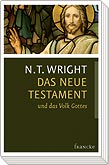Niemand hat am Tag des Todes Jesu den genauen Ablauf protokolliert. Erst später wurde aus vielen Einzelerinnerungen eine zusammenhängende Geschichte. Wir haben sie in den vier Versionen der vier Evangelien, die sich in manchen Details unterscheiden. Im Markusevangelium läuft die Geschichte erstaunlicherweise auf den Henker Jesu zu, den römischen Offizier, der die Hinrichtung leitet. Er ist eine geheime Hauptperson, weil an ihm deutlich wird, wie im Tod Jesu sich seine Kraft erst recht entfaltet.
Die Evangelien sind gerade bei der Passionsgeschichte sparsam mit Deutungen und machen eher durch ihr Erzählen deutlich, worum es ihnen geht. Ich möchte es hier ähnlich machen, indem ich die Geschichte aus der Perspektive dieses römischen Offiziers erzähle. Was kann er uns sagen?
»Normalerweise bin ich nicht in Jerusalem stationiert, sondern in Cäsarea am Meer. Aber wenn in Jerusalem die großen Feste anstehen, dann begibt sich der Gouverneur dorthin und übernimmt selbst das Kommando. Diesmal begleitete auch ich mit meinen Leuten Pilatus nach Jerusalem.
Die Feste der Judäer bedeuten für uns immer Stress. Jerusalem ist voll mit aufgeregten Menschen, und aus einem kleinen Funken kann schnell ein Flächenbrand werden. In den Tagen nach unserer Ankunft merkten wir, dass Spannungen und heftige Diskussionen auch dieses Fest prägten. Trotzdem wäre es für mich wohl ein unbedeutender Einsatz geblieben, wenn der Chef mich nicht am Ende der Festwoche kurzfristig zu einer Hinrichtung eingeteilt hätte.
Hinrichtungen an sich sind für uns nichts Besonderes. Immer mal wieder kommt es vor, dass wir die Ordnung und den Frieden mit drakonischen Maßnahmen aufrecht erhalten müssen. Unsere römischen Truppen in Syrien und Judäa sind eigentlich viel zu schwach, um eine so große und unruhige Provinz zu beherrschen. Einem ernsthaften Aufstand könnten wir nur wenig entgegensetzen. Deshalb müssen wir auch der kleinsten Widersetzlichkeit sofort mit aller Härte entgegentreten. Die Leute sollen Angst vor uns haben. Sie hassen uns sowieso, und sie verachten uns. Das sehe ich, wenn ich mit meinen Leuten durch die Straßen marschiere. Ich war auch schon im Norden an der germanischen Grenze, aber da kann man unbesorgt in ein Gasthaus der Einheimischen gehen. Hier kann man dabei plötzlich einen Dolch zwischen den Rippen haben.
Die Judäer sind anders als die anderen Völker des Imperiums: unruhig, fanatisch – sie haben sich nie damit abgefunden, dass sie nur noch eine Provinz unseres Reiches sind. Es gibt keine Götterbilder, noch nicht mal Statuen des Kaisers, der schließlich auch ein Sohn der Götter ist. Aber gut, das ist Politik. Solange sie Steuern zahlen, lassen wir ihnen ihre merkwürdigen Bräuche.
Aber ich wollte von der Hinrichtung erzählen. Am Tag vor dem Fest brachten morgens die Oberpriester einen Gefangenen zum Chef, angeblich ein Rebell, der sich selbst zum König Israels ausrufen wollte wie schon einige vor ihm. Sie verlangten die Todesstrafe für ihn. Pilatus verhandelte lange mit ihnen; er hatte anscheinend den Verdacht, dass es ihnen in Wirklichkeit um etwas ganz anders ging, und wahrscheinlich hatte er Recht. Aber irgendwie schlossen sie einen Deal miteinander, und der Chef ließ mich holen und beauftragte mich mit der Durchführung der Exekution.
Wenn wir schon einen Rebellen hinrichten, dann bekommt er auch das volle Programm: auspeitschen, kreuzigen, und dann bleibt er da hängen, bis die Vögel sich über ihn hermachen. Sollen die Leute ruhig sehen, was ihnen blüht, wenn sie den römischen Frieden infrage stellen!
Also ließ ich ihn auspeitschen, aber nur so, dass er danach noch lebte und gehen konnte. Wenn man nicht rechtzeitig aufhört, bleibt da kaum noch was übrig, was man kreuzigen kann. Während ich noch einiges vorbereitete, durften die Soldaten dann ihren gewohnten Spaß mit ihm haben. Die sind ja alle frustriert, dass sie in diesem barbarischen Land ihren Dienst tun müssen, zwischen Leuten, die sie hassen, wo es sogar schwierig ist, Wein oder Frauen zu bekommen. Da sind sie froh, wenn sie mal einen von diesen Leuten in die Finger kriegen.
Schon da fiel mir kurz auf, wie wenig ihn das zu beeindrucken schien. Klar, jedem tut es weh, wenn er geschlagen wird. Am Ende blutete er aus der Nase und von den Dornenzweigen, die sie ihm um den Kopf geschlungen haben wie eine Krone. Aber er blieb unbeeindruckt von den Spielchen, die sie mit ihm machten, und eigentlich sind die sonst für meine Leute der größte Spaß. Dieses Good Cop – Bad Cop–Theater, das den Gefangenen normalerweise ihren letzten emotionalen Halt raubt, wenn sie also zwischendurch freundlich und sogar ehrerbietig behandelt werden, nur um sich anschließend um so grausamer entwürdigt zu fühlen: das schien ihn nicht zu beeindrucken.
Das fällt mir aber erst im Rückblick auf. Damals war ich viel zu beschäftigt. Es sollte ja alles schnell gehen. Als ich mit den Vorbereitungen fertig war, suchte ich fünf zuverlässige Leute aus, die so etwas nicht zum ersten Mal machten. Sie luden ihm den Balken auf, und dann ging es los.
Obwohl es noch früh war, waren die Straßen voll. Die Nachricht von der Hinrichtung hatte sich herumgesprochen. Wir kamen nur langsam voran. Und dann brach der Delinquent auch noch zusammen. Da hatten sie wohl doch mit der Peitsche zu viel des Guten getan. Wenn das so weiterging, würden wir den ganzen Tag mit dieser Hinrichtung vertrödeln. Zum Glück stand da an der Straße ein kräftiger Mann; ich ließ ihn von zweien meiner Leute greifen und ihm den Balken aufladen. So ging es schneller.
Schließlich kamen wir an die Stelle, wo die senkrechten Balken für die Kreuzigungen standen. Wir geben den Delinquenten vorher noch Wein mit betäubenden Zusätzen zu trinken, damit sie etwas ruhiger sind beim Annageln. Auch wenn wir so etwas gewöhnt sind, selbst für uns ist es nicht schön, diese schrecklichen Schreie zu hören, wenn die Schmerzen anfangen, die noch etwas ganz anderes sind als die Schmerzen, die die Peitsche verursacht. Aber, und da fiel er mir zum zweiten Mal auf, er probierte einen Schluck, und dann schüttelte er den Kopf. Ganz ruhig und klar. Gut, das war nicht der Moment für Diskussionen. Ich ließ ihn also ohne Wein annageln. Danach zogen sie den Querbalken hoch, bis er in der richtigen Höhe war, und dann kamen noch die Füße dran.
Ich hatte vom Chef die Tafel mit der Kurzfassung des Urteils mitbekommen: »Jesus von Nazareth, König der Juden«, in drei Sprachen. Wir leben in einer globalisierten, vielsprachigen Welt. Pilatus legte Wert darauf, klarzustellen, dass es hier um eine politische Sache ging. Wahrscheinlich musste er sich gegenüber irgend jemandem absichern. Auch Gouverneure sind nicht allmächtig, obwohl die meisten das nicht glauben würden. Ich ließ die Tafel oben am Kreuz anbringen. Immerhin wusste ich jetzt, wie der Mann hieß: Jesus, aus dem Ort Nazareth, aus Galiläa.
Dann kam das lange Warten auf den Tod. Meine Leute vertrieben sich die Zeit mit Würfeln. Sie hatten sich darauf geeinigt, die Tunika dieses Jesus nicht zu zerteilen, sondern sie ganz zu lassen und lieber darum zu spielen.
Währenddessen begann auf einmal diese merkwürdige Prozession von einheimischen Würdenträgern. Das waren nicht die normalen Gaffer, die zu allen Hinrichtungen kommen. Ich sah in ihren Augen denselben Hass, mit denen die Leute sonst uns anschauen. Es ist schon erstaunlich, wie sehr Menschen sich gegenseitig hassen können, obwohl sie beinahe in derselben Lage sind. Wäre es anders, dann hätten wir es viel schwerer mit der römischen Herrschaft, wo wir die Einen gegen die anderen ausspielen. Aber ich sah bei diesen Honoratioren, die unsere Verbündeten sind, noch etwas anderes als nur Hass. Er war zu meiner Verwunderung vermischt mit einer Art Angst. Es war, als ob sie von ihm die Bestätigung hören mussten, dass er gescheitert war. Sie versuchten tatsächlich noch mit ihm zu diskutieren. »Tu ein Wunder und komm runter vom Kreuz!« – das hörte ich ein paar Mal. Und es klang mir so, als ob sie insgeheim befürchteten, er könnte es vielleicht wirklich tun. Aber er antwortete nicht.
Das war das dritte, was mir an ihm auffiel: dass er stumm blieb. Ich habe ja schon viele so sterben sehen. Die Einen brechen zusammen und schreien nur noch »Nein, Nein!« Sie flehen und bitten, und wir müssen sie mit aller Gewalt festhalten, bis die Nägel das übernehmen. Die anderen fluchen und rufen den Zorn ihrer Götter auf uns herab. Die machen uns weniger Ärger, und was den Zorn der Götter betrifft, so haben sich unsere römischen Götter bisher immer noch als die stärkeren erwiesen.
Er aber sagte gar nichts. Er reagierte nicht auf den Hass, der ihm entgegenschlug. Und ich sah auch in seinen Augen nichts davon. Wenn sie auf eine Antwort von ihm gehofft hatten: sie bekamen keine. Als ob sie für ihn gar keine Rolle spielten. Das war seltsam, denn er war noch nicht so weit, dass er nichts mehr mitbekommen hätte, das sah ich.
Gegen Mittag gab es dann eine Sonnenfinsternis. Das war natürlich Zufall, aber irgendwie war ich froh, dass er wenigstens nicht auch noch nackt den höllischen Sonnenstrahlen ausgesetzt war. Und als die Sonne zurückkam, so gegen drei Uhr, da redete er zum ersten Mal. Später habe ich es mir übersetzen lassen. Aber obwohl ich damals nicht verstand, dass er in seiner barbarischen Sprache gerufen hatte »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« – es war genau das, was ich empfand, als ich ihn hörte. In diesem Moment verstand ich, dass sein barbarischer judäischer Gott die ganze Zeit lang sein Gegenüber gewesen war, nicht die Gaffer und die Hasser, noch nicht mal wir, seine Henker. Aber anscheinend auch nicht dieser fürchterliche, grausame Schmerz, den wir ihm bereitet hatten, und den er doch die ganze Zeit über spüren musste. Die ganze Zeit über war dieser fremdartige Gott der Mittelpunkt seiner Existenz geblieben. Kann es so etwas geben?
Ich gehe ja auch mit meinen Leuten in den Tempel und opfere da den verschiedenen Göttern. Seit kurzem gehören nicht nur die verstorbenen Kaiser dazu, sondern auch der jeweils regierende. Gut. das mache ich so, wie ich zu Hause unseren Hausgöttern opfere. Aber auch wenn mir in einem Kampf ein feindlicher Speer die Eingeweide aufreißt, würde ich nie auf den Gedanken kommen, mit einem unserer Götter so zu reden wie er das tat. Ich würde hoffen, dass meine Söhne mich als tapferen Soldaten in Erinnerung behalten und am Hausaltar an mich denken, so wie ich es mit unseren Vätern getan habe. Aber kann ein Mann so mit seinem Gott zusammenhängen, dass alles andere zweitrangig wird? Selbst dann, wenn dieser Gott ihm nicht hilft?
Der Kaiser, so sagen sie, ist ein Sohn der Götter, ein Sohn Jupiters sogar. Aber ich glaube nicht, dass er an Jupiter denken wird, wenn seine Leibgarde wieder einmal putscht und ihn vom Leben zum Tod befördert. Wenn einer in Wahrheit ein Sohn Gottes ist, dann war es der hier, Jesus aus dem unbedeutenden Nazareth im unbedeutenden Galiläa.
Ich weiß nicht, was das bedeutet. Bisher war der Imperator derjenige, dem ich gedient habe, für den ich gelebt und für den ich getötet habe. Auf sein Feldzeichen habe ich geschworen. Er ist ein Sohn Gottes. Aber wenn in Wirklichkeit der hier der wahre Sohn Gottes war: wem will ich in Zukunft dienen?