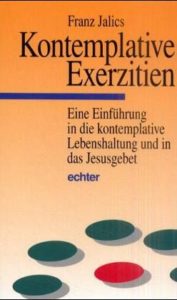Alle Posts dieser Reihe: | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | Teil 5 |
Diese fünfteilige Reihe wurde ursprünglich 2015 für den Blog von Emergent Deutschland geschrieben und für die Veröffentlichung hier leicht überarbeitet.
Bisher ging es um den den gesellschaftlichen Rahmen, in dem sich das Christentum in der Moderne bewegt, und um die grundlegende Arbeitsteilung, auf die sich die Kirche in der bürgerlichen Gesellschaft einließ. Welche Folgen das für die Binnenverfassung des Christentums hatte, soll heute skizziert werden.
Der gesellschaftliche Rahmen, der dem Christentum in der Neuzeit zugewiesen wird, hat dessen Stil und seine Grundannahmen entscheidend geprägt. Das aufsteigenden Bürgertum begegnete einer Kirche, die einerseits spiritualistisch geprägt war und andererseits die ideologische Dominanz über die Gesellschaft robust verteidigte. Das siegreiche Bürgertum zerstörte die ideologische Herrschaft der Kirche, fixierte sie aber andererseits auf einen weltfernen Glauben, der sich für Weltgestaltung nur im engen Rahmen der privaten Moral interessierte.
Das Ergebnis war ein scheinbar schiedlich-friedliches Miteinander: die Kirchenleute verzichteten darauf, sich in die weltlichen Geschäfte der Bürger einzumischen, und die Bürger überließen ihnen gern den Himmel, die Moral und die Tiefen des Gemüts. Der biblische utopisch-prophetische Impuls, der auf eine Welt, die anders ist, zielte, wurde umgelenkt auf die andere, die jenseitige Welt, die wahlweise in der Innerlichkeit, nach dem Tod oder in einer schemenhaften Zukunft verortet wurde. So kam das Christentum zu seinem Aroma der Weltfremdheit, das sich nie wieder ganz vertreiben ließ. Harmlosigkeit zog ein in das »Gemeindeleben«. Bürger und Kleinbürger, insbesondere ihre Frauen und Kinder, fanden hier einen Schonraum, in dem sie sich von den Strapazen der rauen Weltwirklichkeit erholen konnten. Weil inhaltlich nie ganz geklärt war, worum es in der Kirche eigentlich geht, kommt dem Stil eine große Bedeutung zu. Niemand muss mehr wegen Irrlehren vor ein Inquisitionsgericht. Statt dessen sind nun Dresscode, Musikstile, Ästhetik, gesittetes Verhalten und ähnliches die Themen, an denen sich die Gemüter erhitzen.
Weil die real existierende Christenheit sich nicht als Alternative zur bürgerlichen Welt sehen wollte, konnte und durfte, sich aber trotzdem irgendwie unterscheiden musste, suchte sie ihre Identität lange in einem archaisierenden, vormodernen Stil: die Sprache Luthers, die Liturgie der alten Kirche, Frakturschrift und patriarchalische Umgangsformen prägten das Milieu. Milieu? Ja, das ist das Äußerste an Sozialformen, das die bürgerliche Kirche hervorbringt. Denn eigentlich steht im Zentrum von Theorie und Praxis der Einzelne mit seinem Gottesbezug und/oder seinem Gewissen. Für besonders Bedürftige oder Fanatische mag es dann auch noch andere Gesellungsformen geben, die aber schnell unter misstrauischer Beobachtung stehen: wollen die vielleicht etwas Besseres sein als wir anderen normalen Christen? Dann bekommen sie schnell das Etikett der „Sekte“ angeheftet.
Das Christentum im bürgerlichen Rahmen ist vor allem individualistisch. Prinzipiell kann der Bürger seine religiösen Bedürfnisse auch ohne Kirchengebäude und Pfarrer befriedigen: im Wald, in einer stillen Stunde der Besinnung oder mit einem guten Buch. De facto kommt er zwar – wenn er denn überhaupt noch religiös sein will – nicht ohne Institution aus. Auf der liegt aber immer der Makel, eigentlich Obrigkeitskirche zu sein, die im Geheimen womöglich neue Kreuzzüge und Inquisitionen vorbereitet oder auf Gelegenheiten wartet, mühsam errungene sexuelle Spielräume wieder zu kassieren. Eine Identifikation mit dieser per definitionem heuchlerischen Agentur muss auch Kirchenfunktionären erst mühsam antrainiert werden.
Dabei arbeiten die Fachleute der Universitäten und Kirchenämter an einer durchaus anspruchsvollen Aufgabe: das Feuer des Heiligen Geistes muss einerseits am Brennen gehalten werden, andererseits darf es keinen Flächenbrand auslösen. Dieses Gleichgewicht, das es der Kirche erlaubt, eine gewisse Relevanz für den Einzelnen zu behalten, ohne in echten Konflikt mit der kapitalistisch geprägten Gesellschaft zu geraten, muss immer wieder mühsam austariert werden und ist ein weiteres Kennzeichen des real existierenden bürgerlichen Christentums.
Gemeinde als gesellschaftliche Alternative, die man nur gemeinsam leben kann (die biblische „neue Schöpfung“ also), ist im bürgerlichen Rahmen nicht im Blick. Dafür sorgt zuverlässig der moderne Individualismus, der auch schon der Arbeiterbewegung den Garaus gemacht hat. Er hat immer noch das Pathos der Freiheit auf seiner Seite und ist bis heute das selbstverständliche Terrain, auf dem sich Theologie und Gemeinde bewegen.
Gemeinde als kollektiv gelebte Alternative zur gesellschaftlichen Marktlogik (Tobias Faix hat unter den Stichworten »Anschlussfähigkeit und Kontrastgesellschaft« den Rahmen dafür beschrieben) gerät schnell unter Dominanz- und Fundamentalismus-Verdacht. Intern gerät sie zwischen die Mühlsteine von Liberalen (die Fremdbestimmung und Dominanz fürchten wie der Teufel das Weihwasser) und Fundis (die immer noch von der gesellschaftlichen Dominanz einer Kirche träumen, die sich auf Himmel und Unterleib konzentriert).
Gemeinde als gemeinsam gelebte Alternative kann nur sehr spärlich auf real existierende Vorbilder, Traditionen und Erfahrungen zurückgreifen, die für 08/15-Normalgemeinden zu realistischen Modellen werden könnten. Neue Ansätze haben zu kämpfen mit institutionellen Blockaden und der Nötigung, parallel dazu immer noch den alten Laden am Laufen zu halten. Praktikable Modelle und passende Theologien sind, freundlich gesagt, noch ausbaufähig. Vor allem aber ist es ein elastisch-stabiles Netz von Ängsten, Mentalitäten und theologischen Mantren, das Christen nach gelegentlichen Freigängen immer wieder in ihr individualistisches Gefängnis zurückholt.
Das war nun vielleicht kein besonders motivierender Schluss. Aber im vierten Teil kommt dann endlich das Positive.
Alle Posts dieser Reihe: | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | Teil 5 |