Ich habe in den letzten Wochen zwei Bücher über bzw. von Barack Obama gelesen: ein Buch über seine Rhetorik („Sags wie Obama“ von Shel Leanne) und seinen eigenen Bericht über seine Identitätsfindung („Ein amerikanischer Traum. Die Geschichte meiner Familie“).
 Das erste Buch ist eigentlich nur wegen der ausführlich wiedergegebenen Reden lesenswert. Beim Lesen der Reden bestätigt sich im Detail der Eindruck, den die Fernsehübertragungen hinterlassen haben: hier spricht einer, der es wirklich kann. Seine Reden sind politische Predigten, und alle, die Predigten für etwas Langweiliges halten, müssen sich eines Besseren belehren lassen. Thema ist fast immer die Wiedergewinnung von Einheit und Solidarität durch die Erneuerung der freiheitlichen amerikanischen Traditionen (Unabhängigkeitskrieg, Besiedelung des Landes, Lincoln, Große Depression und New Deal, Kampf gegen den Faschismus, Kennedy, M.L. King und die Bürgerrechtsbewegung). Beim Lesen wird deutlich, dass man die Geschichte der USA tatsächlich als erfolgreiche Freiheitsgeschichte erzählen kann. Und Obama kann sie so erzählen, dass man elektrisiert ist. Die Schattenseiten dieser Geschichte tauchen eher am Rande auf. Zwischen den Zeilen merkt man, dass Obama sie kennt, sie aber mit Nichtbeachtung straft oder im Interesse der Einheitsthematik höchstens andeutet. Es ist schon eine erstaunliche Leistung, wie Obama offensiv einen freiheitlich-sozialen Patriotismus definiert und ihn gegen das Bush-Amerika wendet.
Das erste Buch ist eigentlich nur wegen der ausführlich wiedergegebenen Reden lesenswert. Beim Lesen der Reden bestätigt sich im Detail der Eindruck, den die Fernsehübertragungen hinterlassen haben: hier spricht einer, der es wirklich kann. Seine Reden sind politische Predigten, und alle, die Predigten für etwas Langweiliges halten, müssen sich eines Besseren belehren lassen. Thema ist fast immer die Wiedergewinnung von Einheit und Solidarität durch die Erneuerung der freiheitlichen amerikanischen Traditionen (Unabhängigkeitskrieg, Besiedelung des Landes, Lincoln, Große Depression und New Deal, Kampf gegen den Faschismus, Kennedy, M.L. King und die Bürgerrechtsbewegung). Beim Lesen wird deutlich, dass man die Geschichte der USA tatsächlich als erfolgreiche Freiheitsgeschichte erzählen kann. Und Obama kann sie so erzählen, dass man elektrisiert ist. Die Schattenseiten dieser Geschichte tauchen eher am Rande auf. Zwischen den Zeilen merkt man, dass Obama sie kennt, sie aber mit Nichtbeachtung straft oder im Interesse der Einheitsthematik höchstens andeutet. Es ist schon eine erstaunliche Leistung, wie Obama offensiv einen freiheitlich-sozialen Patriotismus definiert und ihn gegen das Bush-Amerika wendet.
Im Vergleich dazu merkt man erst richtig, wie arm Deutschland an geschichtlich realisierten freiheitlichen Traditionen ist. Amerika ist von denen gegründet worden, die hier in Europa keinen Platz mehr hatten und ein gesundes Misstrauen gegen eine übermächtige Staatsmacht entwickelten. Das schuf Raum für Mythen und Visionen, die Obama mit „Yes, we can“ genial zusammengefasst hat. In Deutschland dagegen hat die Staatsmacht noch jede nicht von ihr kontrollierte Bewegung der Menschen entweder zerschlagen, totignoriert, diffamiert, entschärft oder sich selbst unter den Nagel gerissen. Uns hat man das Können ausgetrieben oder madig gemacht. Das gilt für Politik wie Kirche. Die deutsche demokratische Bewegung von 1848 ist – anders als die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung von 1776 – gescheitert. Wir hatten keinen Kennedy und keinen Martin Luther King.
Dennoch kann es sinnvoll sein, nach gelungenen Passagen in der deutschen Geschichte zu suchen, die eine Grundlage für eine gemeinsame Identität abgeben können. Auch wenn sie weniger glanzvoll sind. Vielleicht wäre die Erarbeitung des Grundgesetzes solch eine viel zu selten genutzte Erinnerung. Oder der Aufbruch von 1968 als nachgeholte eigene Verabschiedung von Faschismus und Obrigkeitsstaat. Oder die friedliche Revolution in der DDR.
An diesen Beispielen wird aber auch der Unterschied schmerzlich bewusst: die Kämpfe um die amerikanische Unabhängigkeit sind ein Mythos, den die ganze Nation teilt, mit Heroen und Schurken, Kämpfen und Opfern, mit Glauben, der auch angesichts von Niederlagen durchhält. Dagegen fällt natürlich die Nationalversammlung von 1848 oder auch ein Verfassungskonvent ziemlich ab. 1968 hat nur ein Teil der Bevölkerung als Befreiung erlebt. Und die friedliche Revolution von 1989 hat fast niemanden, der sich im Nachhinein noch damit identifizieren möchte. Warum?
Ähnlich ist es mit der Kirchengeschichte. Vielleicht taugt gerade noch Bonhoeffer zur fraktionsübergreifend anerkannten Heiligengestalt. Verdient hat er es allemal. Aber als Erfolgsgeschichte kann man sein Leben kaum erzählen, noch nicht mal in dem Sinn, dass seine Entdeckungen nach seinem Tod umgesetzt worden wären (hoffentlich kommt das noch).
Lange Zeit war Martin Luther in der evangelischen Hälfte Deutschlands ein allgemein anerkannter Heros. Nicht so sehr seine Schattenseiten (die ja beim zweiten Blick fast alle Heldengestalten haben) haben ihn inzwischen beschädigt, sondern viel mehr das polternde Pathos seiner Anhänger, die sich bei ihm eine Stärke holen wollten, über die sie selbst nicht verfügen. Nicht selten sorgt die Rezeptionsgeschichte erst dafür, dass historische Gestalten und Ereignisse als Orientierungspunkte verbrannt werden.
Somit wird die Suche nach positiven kirchlichen Traditionen oft erst an fernen Orten fündig: die irischen Mönche, die frühen mitteleuropäischen Missionare, Teile des Mönchtums überhaupt, Franz von Assisi, die englischen Kämpfer gegen den Sklavenhandel.
Unter dem Strich bleibt uns die Aufgabe einer kritischen, dialektischen Aufnahme unserer Traditionen. Ohne ihre Schattenseiten zu verleugnen, sollten sie doch als Quelle der Inspiration gelesen werden. Der Pietismus, die Herrnhuter, die Aufklärung (ja, auch die!), die christlichen Jugendbewegungen, die Bekennende Kirche, da gibt es wohl noch einiges zu entdecken. Nicht zuletzt vielleicht auch in der Geschichte der je eigenen Gemeinde. Wie gesagt, kritische Aufnahme, denn es gibt eben auch viel Enttäuschendes. Und trotzdem: wer es schafft, die Menschen an ihre besten Seiten (bzw. Traditionen) zu erinnern, kann Erstaunliches freisetzen. Das ist Obama auf eine massentaugliche und dennoch verantwortliche Weise gelungen. Der Erfolg hat ihn bestätigt.
Ist Obama aber glaubwürdig? Wird er über kurz oder lang sein Charisma einbüßen, so dass sich die Berufsskeptiker im deutschen (nicht nur journalistischen) Geschäft auf die Schulter klopfen können, weil sie das schon immer kommen sahen? Antworten dazu habe ich in Obamas Buch über seine Familiengeschichte gesucht, das ja schon lange Zeit vor seiner politischen Karriere (nämlich 1995) geschrieben wurde. Mehr darüber im nächsten Teil.
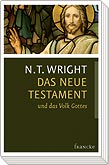
Pingback: www.buch.de - über uns